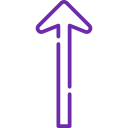Beim Fesselringbandsyndrom kommt es zur Einschnürung der Beugesehnen (oberflächliche und tiefe Beugesehne) durch das Fesselringband. Dies führt zu Schmerzen und damit verbunden nicht selten zur Lahmheit bei betroffenen Pferden.
Je nach Ursache der Einschnürung unterscheidet man dabei zwischen dem primären und sekundären Fesselringbandsyndrom:
Betroffene Pferde zeigen verschiedene Auffälligkeiten, die auf dieses Syndrom hinweisen können. Aufgrund der Verengung kommt es zu Schwellungen und einer typischen „sanduhrförmigen“ Einschnürung auf der Rückseite des Beines, die oberhalb des Fesselkopfes zu erkennen ist. Im Bereich der Fessel sind die Pferde außerdem häufig schmerzhaft.
Durch die Beeinträchtigung des Sehnenapparates kann sich ebenfalls eine deutliche Lahmheit zeigen, das betroffene Bein wird dabei bestmöglich entlastet und zumeist nicht mehr vollständig durchgedrückt. Eine solche Entlastung findet auch oft im Stand statt, wobei das Pferd das beeinträchtigte Bein dann nur auf der Zehenspitze aufsetzt.
Bei dem Verdacht auf eine Veränderung im Bereich des Fesselringbandes führt der Tierarzt zunächst ein ausführliches Anamnesegespräch, gefolgt von einer klinischen Untersuchung. Mittels Ultraschall kann die anfängliche Verdachtsdiagnose dann bestätigt oder ausgeschlossen und das Ausmaß der Erkrankung dargestellt werden. Ein gesundes Fesselringband sollte nicht dicker als 3mm sein. Auch kann per Ultraschall festgestellt werden ob es sich nur um ein verdicktes Fesselringband handelt oder ob auch die innerhalb der Fesselbeugesehnenscheide gelegenen Strukturen (OBS, TBS, Manica Flexoria) betroffen sind.
Zur Behandlung des Fesselringbandsyndroms
stehen sowohl operative als auch konservative Behandlungen zur
Verfügung. Es ist jedoch anzumerken, dass eine
konservative Behandlung nur in akuten Fällen zu empfehlen ist und leider häufig
zu Rezidiven (erneutem Auftreten) führt. Teilweise ist es noch möglich, mithilfe von entzündungshemmenden Medikamenten, Hydrotherapie und strikter Ruhe
eine Verbesserung der Erkrankung zu erreichen. Auch Spezialbeschläge können
Linderung verschaffen. Dies sollte jedoch im Einzelfall ausführlich besprochen
werden, um die Therapie individuell anzupassen und eine mögliche
Verschlechterung der Erkrankung in jedem Fall zu vermeiden. Ein zu lange
bestehendes Fesselringbandsyndrom kann sehr gravierende Folgen für die
innerhalb der Fesselbeugesehnenscheide liegenden Strukturen haben, denn durch
die Einschnürung kann es zum Zerreißen von Fasern, Entzündungen oder
Verklebungen kommen.
Deutlich häufiger ist eine operative
Behandlung notwendig. In diesem chirurgischen Verfahren erfolgt die
Durchtrennung des Fesselringbandes, um die Sehnen von der Einschnürung zu
befreien. Diese Operation wird minimalinvasiv, also mittels endoskopischer
Chirurgie durchgeführt (Tendovaginoskopie). Hierbei können zusätzlich die
einzelnen Sehnen betrachtet und eventuelle Sehnenschäden diagnostiziert und
behandelt werden. Der Eingriff erfolgt in Vollnarkose und ist ein
Routineeingriff. Wie bei allen Operationen besteht das übliche, aber geringe
Narkoserisiko.
Ob und inwieweit ein betroffenes Pferd nach der Behandlung noch reitbar ist, ist vorrangig von der Form und Schwere der Erkrankung abhängig.
Das primäre Fesselringbandsyndrom ohne Verletzungen der Sehnen weist daher gute Heilungschancen auf. Nach Beseitigung der Einschnürung heilen betroffene Beine meist vollständig aus und die Pferde können nach einer gewissen Ruhezeit langsam wieder antrainiert werden.
Beim sekundären Fesselringbandsyndrom hingegen bestehen häufig bereits deutliche Sehnenverletzungen, die eine eher vorsichtige Heilungstendenz zeigen. Abhängig von Schwere und Umfang der Verletzungen ist hier von einer deutlich längeren Heilungsphase auszugehen. Wie weit ein weiterer Einsatz als Sport- oder Freizeitpferd nach Abheilung dann noch möglich ist, ist im Einzelfall in der Operation zu bewerten.
Grundsätzlich gilt, dass ein Fesselringband therapiert werden sollte, bevor es zu Sehnenverletzungen kommt, da diese die Prognose deutlich verschlechtern. Nach einer erfolgten Operation kann eine deutlich bessere Prognose gestellt werden, da man das Ausmaß der Verletzung und mögliche Verklebung intraoperativ besser beurteilen konnte.